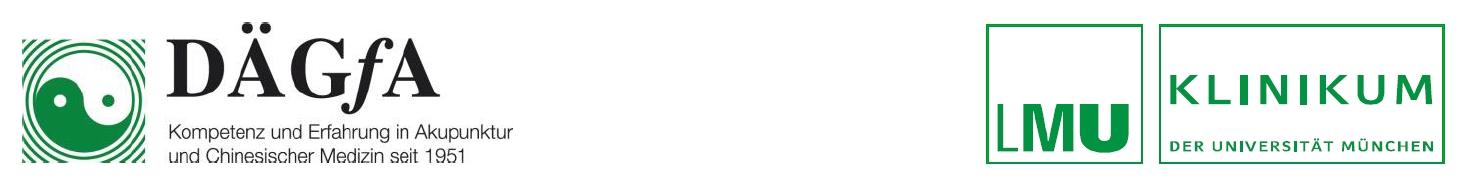VORTRÄGE
Priv.-Doz. Dr. Dominik Irnich, Klinik für Anästhesiologie, Interdisziplinäre Schmerzambulanz Campus Innenstadt, Ludwig-Maximilians-Universität München sowie Leiter des Fortbildungszentrums der Deutschen Ärztegesellschaft für Akupunktur (DÄGfA), eröffnete das 2. Symposium „Akupunktur in der Behandlung psychiatrischer und psychosomatischer Erkrankungen“. Er begrüßte die etwa 100 interessierten Kolleginnen und Kollegen, die am 14.11.2015 an das Max-Planck-Institut für Psychiatrie nach München gekommen waren.
Irnich erinnerte an die sehr lange Geschichte der Behandlung psychiatrischer Krankheitsbilder mit Akupunktur in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Seit ihrer Gründung 1951 hat sich auch die DÄGfA intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Pioniere wie Bachmann, Gleditsch und Wancura haben schon früh Parallelen zwischen psychosomatischer Medizin und der ganzheitlichen Sichtweise der TCM hergestellt. Darüber hinaus hat die DÄGfA die Entwicklung der Akupunktur nach dem NADA-Protokoll bei Sucht seit Beginn dieser Bewegung in den USA unterstützt. Irnich drückte seine große Freude darüber aus, dass die Akupunktur bei psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen in den Universitätskliniken angekommen ist und bei fachspezifischen DÄGfA-Kursen gelehrt wird. Die wissenschaftliche Evaluation und kritische Prüfung möglicher Indikationen sowie die Integration der Akupunktur in bestehende Therapiekonzepte ist für die DÄGfA als Fachgesellschaft essentieller Bestandteil.
Dr. Stefan Kloiber, Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, berichtete in seinem ersten Vortrag über die Etablierung der Ohrakupunktur nach dem NADA-Protokoll in der Klinik und in den Tagkliniken des Instituts seit 2014. Seither ist die NADA-Ohrakupunktur fester Bestandteil des therapeutischen Programms. Bei Patienten mit verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen (zur Reduktion von Anspannung und Unruhe, bei Schlafstörungen, bei Angstsymptomen, bei Entzugssymptomen etc.) wird sie mit Erfolg und bei sehr guter Verträglichkeit komplementär eingesetzt.

Die Dozenten des Symposiums (v.l.n.r.): Dr. Peter Summa-Lehmann, Dr. Richard Musil, Dr. Johannes Fleckenstein, Jürgen Mücher, Priv.-Doz. Dr. Dominik Irnich, Dr. Stefan Kloiber, Dr. Bastian Wollweber und Till Nierhaus, M.Sc., Dipl.-Ing. (FH).
Dr. Bastian Wollweber, Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, präsentierte erste Anwendungsbeobachtungen der Etablierung von Ohrakupunktur nach dem NADA-Protokoll als Gruppentherapie im Rahmen eines stationären und tagklinischen Therapiekonzepts zur Behandlung insbesondere von depressiven Störungen. Die in Einzelfallbeobachtungen gewonnenen Ergebnisse weisen darauf hin, dass NADA-Akupunktur bei Personen mit einem depressiven Syndrom – im Vergleich zu anderen, ebenfalls auch einzeltherapeutisch anwendbaren Verfahren wie beispielsweise Progressive Muskelentspannung (PMR) – möglicherweise stärkere kurzfristige Effekte auf bestimmte Symptome hat. Dazu gehören die Besserung der momentanen psychischen Befindlichkeit (gemessen mittels Bf-SR Befindlichkeits-Skala von Zerssen), die Besserung der Stimmung und die Abnahme von Unruhe (jeweils ermittelt per MDBF, Mehrdimensionaler Befindlichkeitsfragebogen, Steyer et al.) sowie die Abnahme von Angst (laut numerischer Ratingskala). Aufgrund der kurzfristigen Wirksamkeit bei Personen mit einem depressiven Syndrom, die sich auch im Langzeitverlauf weiter zeigt, könnte NADA-Ohrakupunktur nicht nur als komplementäre Dauertherapie, sondern auch als bedarfsweise Behandlung und Akuttherapie depressiver Störungen geeignet sein.
In seinem Vortrag referierte Dr. Peter Summa-Lehmann, ehemaliger Chefarzt der Psychiatrischen Fachklinik Düren sowie NADA Deutschland, über die strukturierte Anwendung des NADA-Protokolls am Beispiel der Behandlung von Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen und Posttraumatischen Belastungsstörungen. Je nach Bedarf kann diese standardisierte Ohrakupunktur als Kurzintervention eingesetzt werden und/oder in Kombination mit störungsspezifischen Therapiemodulen als Therapie in der Gruppe. Die Grundhaltung von Achtsamkeit und Empathie ermöglicht es – ergänzt durch Modifikation des Settings –, auch Patienten mit Posttraumatischer Belastungsstörung sicher im Rahmen des jeweiligen Gesamttherapiekonzepts in einer Gruppe zu behandeln.
Jürgen Mücher, Arzt für Naturheilverfahren und Akupunktur, Bremen, sowie DÄGfA-Dozent, referierte in seinem Vortrag über die wichtigsten Grundlagen für das Verständnis der Psyche in der Chinesischen Medizin. Ausgehend von den „Drei Schätzen“ Geist, Qi und Essenz stellte er mit den Fünf Speicherorganen die Instanzen vor, in welchen diese Kräfte im Organismus wirksam werden und in denen fünf spezifische Aspekte des Geistes mit je einer Gruppe von körperlichen Funktionen in inniger Verbindung stehen. Darauf aufbauend besprach er die Symptome, die aus einer Störung dieser psychosomatischen Einheit resultieren.
In seinem Vortrag stellte Dr. Richard Musil, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ludwig-Maximilians-Universität München, Ideen zur Integration von Konzepten der chinesischen Medizin in moderne Psychotherapieverfahren vor. Die inneren pathogenen Faktoren oder emotionalen Aspekte der Fünf-Wandlungsphasen-Theorie ähneln dabei Vorstellungen der Basisemotionen. Ein Vorteil der chinesischen Konzepte sind die wechselseitigen Beziehungen der Emotionen und damit therapeutische Beeinflussungsmöglichkeiten, wie sie in klassischen Texten beschrieben sind. Dies lässt sich bei der Arbeit mit PatientInnen im Sinne einer Emotionsregulation – besonders im Rahmen von imaginativen Übungen und Arbeit an inneren Kindanteilen – einsetzen. Auch synergistische Effekte auf die Lernfähigkeit im psychotherapeutischen Prozess durch eine Kombination von nicht-invasiven Hirnstimulationstechniken mit Psychotherapieverfahren, wie dies bereits für die Gleichstromstimulation gezeigt wurde, wären mit Elektrostimulationsakupunktur denkbar. Darüber hinaus bietet die chinesische Medizin eine Vielzahl von Anleitungen zur gesunden Lebensführung (Yangsheng), die eine Psychoedukation gewinnbringend erweitern kann.
Dr. Johannes Fleckenstein, Abteilung Traditionelle Chinesische Medizin und Akupunktur, Institut für Komplementärmedizin KIKOM, Universität Bern, sowie Institut für Sportwissenschaften, Abteilung Sportmedizin, Goethe-Universität Frankfurt am Main, ging in seinem Vortrag auf den Zusammenhang zwischen Schmerzen und Psyche ein. Das biopsychosoziale Schmerzmodell steht dabei als möglicher Erklärungsansatz im Mittelpunkt einer adäquaten Behandlung. Anschaulich zeigte er anhand von Daten aus klinischen Studien, dass eine Akupunkturbehandlung sowohl das Schmerzempfinden als auch psychische Symptome zu lindern vermag. Tierexperimentelle Arbeiten legen dabei nahe, dass diese Effekte durch eine Ausschüttung körpereigener Peptide, die in den „Belohnungszentren“ des Gehirns wirken, vermittelt werden.
Till Nierhaus, M.Sc., Dipl.-Ing. (FH), Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig sowie MRT – Center for Cognitive Neuroscience Berlin, Freie Universität Berlin, berichtete über Akupunktur aus neurophysiologischer Sicht, wobei die Verwendung von Akupunkturnadeln als komplexe somatosensorische Stimulation angesehen werden kann. In seinem Vortrag beschrieb er zunächst, wie die somatosensorische Reizverarbeitung generell mittels Elektroenzephalographie (EEG) oder funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) abgebildet werden kann. Anschließend wurden die Ergebnisse einer Akupunkturstudie vorgestellt und die beobachteten Akupunkturpunkt-spezifischen Effekte im Rahmen einer möglichen Schmerzmodulation durch Akupunktur diskutiert.
Dr. Stefan Kloiber rückte in seinem Vortrag zu Akupunktur bei Stress-assoziierten Erkrankungen zwei wichtige, an der Stressverarbeitung beteiligte biologische Mechanismen in den Vordergrund: das Stresshormonsystem und das vegetative Nervensystem. In einer Zusammenfassung der wissenschaftlichen Literatur stellte er verschiedene Studien vor, die darauf hinweisen, dass sich diese Stresssysteme durch Akupunktur positiv beeinflussen lassen. In den einzelnen Studien hatte sich Akupunktur bei depressiven Symptomen, Angstsymptomen, Schlafstörungen und posttraumatischen Störungen als wirksam erwiesen. Besonders wurden dabei die komplementäre Anwendung von Akupunktur bei depressiven Erkrankungen zusätzlich zu einer Pharmakotherapie sowie die Anwendung bei Patienten mit Depression und Schmerzerkrankung hervorgehoben. Insgesamt fehlt es jedoch aktuell noch an wissenschaftlicher Evidenz, um klare Empfehlungen aussprechen zu können.
WORKSHOPS
 Dr. Peter Summa-Lehmann diskutierte mit den Teilnehmern seines Workshops die Einsatzmöglichkeiten der standardisierten Fünf-Punkte-Kombination (NADA-Protokoll) im Einzel- und im Gruppensetting bei unterschiedlichen Praxisfeldern. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten der akuten Hilfe für Flüchtlinge (z.B. Einsatz von Ohrakupunktur) offen und kontrovers erörtert.
Dr. Peter Summa-Lehmann diskutierte mit den Teilnehmern seines Workshops die Einsatzmöglichkeiten der standardisierten Fünf-Punkte-Kombination (NADA-Protokoll) im Einzel- und im Gruppensetting bei unterschiedlichen Praxisfeldern. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten der akuten Hilfe für Flüchtlinge (z.B. Einsatz von Ohrakupunktur) offen und kontrovers erörtert.
Dr. Stefan Kloiber stellte in seinem Workshop zur Ohrakupunktur bei psychischen Erkrankungen das Behandlungskonzept der NADA jenem der klassischen Ohrakupunktur gegenüber. Er präsentierte Ohrakupunkturpunkte und Punktkonzepte der Ohrakupunktur bei psychischen Störungen und Symptomen, die bisher überwiegend auf einer empirischen Grundlage basieren. Zudem diskutierte er mit den Teilnehmern aktuelle und interessante Studien zu Ohrakupunktur bei psychischen Symptomen und Erkrankungen.
Dr. Richard Musil präsentierte Fälle aus seiner klinischen Praxis, die besondere Indikationsgebiete für einen Einsatz von Ohr- und Körperakupunktur bei depressiven PatientInnen beschreiben. Diskutiert wurden der Einsatz von Akupunktur bei Schwangeren, Akupunktur zur Therapie von begleitenden Körpermissempfindungen bei Depressionen sowie Akupunktur zur Unterstützung bei metabolischen Nebenwirkungen einer psychopharmakologischen Behandlung.
 Jürgen Mücher erörterte in seinem Workshop über die Psychosomatik emotionaler Störungen aus Sicht der Chinesischen Medizin deren Konzepte von Basisemotionen in Form der Fünf Willenskräfte und der Sieben Leidenschaften. Für letztere erklärte er deren mögliche schädigende Einflüsse auf die Fünf Speicherorgane und die jeweils zugehörige psychische und somatische Symptomatik. Anhand von Beispielen erläuterte er die in diesen Situationen geeigneten Behandlungsstrategien mit Akupunktur und Chinesischer Arzneitherapie.
Jürgen Mücher erörterte in seinem Workshop über die Psychosomatik emotionaler Störungen aus Sicht der Chinesischen Medizin deren Konzepte von Basisemotionen in Form der Fünf Willenskräfte und der Sieben Leidenschaften. Für letztere erklärte er deren mögliche schädigende Einflüsse auf die Fünf Speicherorgane und die jeweils zugehörige psychische und somatische Symptomatik. Anhand von Beispielen erläuterte er die in diesen Situationen geeigneten Behandlungsstrategien mit Akupunktur und Chinesischer Arzneitherapie.
___________________________________________________________________________________
Das nächste Symposium „Akupunktur zur Unterstützung psychiatrischer Therapiekonzepte“ in Kooperation mit der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Ludwig-Maximilians-Universität München, ist für den 12.11.2016 geplant.